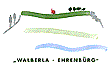
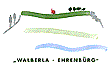 |
|
|
Lage des bearbeiteten Gebietes Bemerkungen zu den einzelnen Arten Der Orchideenbestand der Ehrenbürg Folgerungen für den Naturschutz Anhang Liste gefährdeter Arten im Untersuchungsgebiet Realisation durch faktor i, mit freundlicher Genehmigung der Autoren A. Riechelmann und A. Zirnsack. |
Breitblättrige StendelwurzEpipactis helleborine (L.) CRANTZ
Auffallend ist auch bei Epipactis helleborine der hohe Anteil steriler Pflanzen; er liegt im Bereich der Ehrenbürg zwischen 40 und 50 Prozent. Sie benötigt lichte bis halbschattige Wuchsorte, die sie in der Regel in den Randzonen der Wälder, den Lichtungen und an den Wegrändern findet. An ihr weniger zusagenden Standorten wie z. B. im Lindenreichen-Hangbuchenwald an der Nordseite der Ehrenbürg, beträgt die Lichtmenge während der meisten Zeit des Tages selten mehr als 1000 Lux. Nur in den späten Nachmittagsstunden, wenn die Sonne kurzzeitig auf den Waldboden trifft, erreicht die Beleuchtungsstärke maximal 5000 Lux. Diese Lichtmenge reicht der Pflanze nicht, um zum Blühen zu gelangen. SEELAND (1929) vermerkt, "daß bei ungünstigen Standortverhältnissen die Pflanze zur Jugendform zurückkehrt und als "planta hypogaea" im tiefen Waldschatten von den durch die Pilze vermittelten Nährstoffen lebt und so das Überwachsen übersteht, um alsbald nach dem Schlagen des Waldes wieder in Blüte zu erscheinen". REINEKE (1998) hingegen bezeichnet dieses Phänomen vorwiegend steriler Populationen als "Sproßbanken". Nach seinen Untersuchungen sind verschiedene Orchideenarten in der Lage, Kümmerwuchs-Populationen auszubilden und in diesem Zustand längere, ungünstige Phasen ihrer Standorte, hauptsächlich starke Beschattung, zu überdauern. In solchen Populationen gelangen nur wenige Pflanzen zum Blühen und zum Fruchten. Die von ihnen ausgehenden und von außerhalb anfliegenden Samen lassen Ersatz für die absterbenden Pflanzen entstehen. Auf diese Weise kann eine Population unter Umständen Jahrzehnte fortbestehen bei nur schwacher Erneuerungs- und Ausbreitungskraft. Durch Verbesserung der Umgebungsbedingungen, vornehmlich eine stärkere Belichtung, bilden die Populationen schnell eine große Anzahl fruchtender Pflanzen aus und erreichen in kurzer Zeit eine kräftige Durchmischung des Genpools. Mit diesem Verhalten können die Pflanzen ihr Defizit kompensieren, keine ausdauernden Diasporenbanken bilden zu können.
Meist bleiben die Stümpfe der abgeschlagenen Bäume am Leben und schlagen schnell wieder aus. Die lebenden Wurzeln durchziehen weiterhin den Boden, was einerseits eine geringere Erosionsgefahr und andererseits ein geringeres Nährstoffangebot gegenüber den Kahlschlägen bedeutet, wo die abgeschlagenen Wurzeln mineralisiert werden können (BRACKEL & ZINTL 1983). Durch das zügige Ausschlagen finden Waldpflanzen Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung wie auch vor Abstrahlung in der Nacht und bleiben so auf vielen kleinen Inseln über den Schlag verteilt erhalten. Auch Pflanzen der Saumgesellschaften können sich im Schutze der jungen, strauchförmigen Bäume ansiedeln. Weil keine neuen Pflanzungen vorgenommen werden und beim Abtransport der kleineren und leichteren Stämme des Niederwaldes der Boden weniger verletzt wird, kann sich Epipactis helleborine rasch wieder ausbreiten. Ein weiterer Grund dafür, daß diese Orchidee dem Konkurrenzkampf besser gewachsen ist, liegt neben ihren bescheidenen Ansprüchen an den Kalkgehalt des Bodens und an die Lichtverhältnisse vor allem daran, daß sie mehr als andere Orchideen Stickstoff verträgt. DIETERICH (1965) berichtet von einem massierten Auftreten von Epipactis helleborine nach Düngungsmaßnahmen in einem Waldgebiet im Schwarzwald und führt dies auf die durch die Düngung veränderten Humusformen zurück, die dann dem Orchideensamen bessere Keimungsmöglichkeiten bieten. Eine gewisse Stickstoffverträglichkeit ist in unserer Kulturlandschaft, wenn auch kleinräumige aber weitverbreitete Biotoptypen von Orchideen angenommen werden, ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Den am besten besetzten Standort der Breitblättrigen Stendelwurz, er ist mit mehr als 70 Pflanzen bestückt, fanden wir auf dem Gipfelplateau der Ehrenbürg. Es handelt sich um eine thermophile Schlagflur auf Malmschutt am Rande einer landwirtschaftlich genutzten Fläche (auf die pflanzensoziologische Zusammensetzung wird bei Listera ovata näher eingegangen). Vor allem die Rot-Buche (Fagus silvatica) und die Stil-Eiche (Quercus robur) wurden an diesem Wuchsort vor Jahren auf Stock gesetzt und erreichen inzwischen schon wieder eine Mächtigkeit von mehr als sieben Metern. Im Randbereich dieses Saums findet Epipactis helleborine ideale Bedingungen, denn durch die Südwestexposition und den sich schnell erwärmenden Kalk erhalten die Pflanzen Wärme und Lichtgenuß (maximale Beleuchtungsstärke 20 000 Lux). Der Blühbeginn liegt bei der Breitblättrigen Stendelwurz im Bereich der Ehrenbürg in der letzten Juliwoche. Stattliche Pflanzen von über 90 Zentimeter Wuchshöhe sind keine Seltenheit; an der größten Pflanze zählten wir Mitte September 61 prall gefüllte Fruchtkapseln, die bereits ausgesamt hatten. Doch nur wenige Meter weiter im Zentralbereich des Niederwaldes wird die Sonneneinstrahlung durch den sich sehr üppig entwickelnden Unterwuchs stark reduziert (maximale Beleuchtungsstärke 10 000 Lux), so daß die Pflanzen nur zwischen 15 und 20 Zentimeter hoch wachsen und nur wenige Blüten ausbilden. Die Fruchtkapseln fanden wir Ende September noch geschlossen vor. Im Randbereich der Schlagflur lagen die pH-Werte für den trockenen Ah-Horizont zwischen 6,6 und 7,0 / 5 Messungen ( 6,0 / 3 Messungen). In einer Epipactis-helleborine-Population, die wir in einer Verlichtung des Wärmeliebenden Eichenmischwaldes an der Südwestseite des Rodenstein Ende August 1998 kartierten, fielen uns einige besonders zierliche Pflanzen von geringer Wuchshöhe auf. Der Habitus dieser Pflanzen wurde geprägt durch kleine, länglich schmale Blätter von gelbgrüner Färbung, von denen das unterste relativ erdfern ansetzt. Als charakteristisch erwiesen sich ferner die kurzen, gegeneinander gewinkelten Internodienabschnitte (die Winkel lagen zwischen 120 Grad und 140 Grad), wodurch der äußerst dünne Stengel sich zick-zack-förmig nach oben streckte (bessere Stabilität?).Während bei den "normalen" Epipactis-helleborine-Pflanzen die Fruchtkapseln einen kurzen Stil aufweisen und parallel zum Stengel nach unten hängen, stehen die Fruchtkapseln der "Zick-Zack"-Helleborine mit einem deutlich längerem Stil fast waagrecht ab und bilden mit dem Stengel einen Winkel von annähernd 90 Grad. Über ähnliche Pflanzen berichtet TIMPE (1997) vom Hohensteinmais bei Kirchfidisch im Südburgenland/Österreich. Obwohl sich die "Zick-Zack"-Helleborine von der "normalen" Helleborine im Bereich der Ehrenbürg morphologisch deutlich unterscheidet, scheinen die ökologischen Standortansprüche beider Typen nahezu identisch zu sein. Bei dem trockenen und flachgründigen Boden der ca. 20 Quadratmeter messenden Verlichtung handelt es sich um eine Proto-Rendzina. Der pH-Wert des Ah-Horizonts ergab für beide Epipactis-Typen den Wert 6,8 / 4 Messungen (5,4 - 6,2 / 5 Messungen). Die Beleuchtungsstärke lag zwischen 1000 Lux im Schatten der Bäume und 5000 Lux auf sonnenbeschienenem Waldboden. Fundierte Aussagen über den taxonomischen Wert dieser Beobachtungen setzen eine gründliche und umfangreiche Blütenanalyse voraus, die erst im Sommer 1999 möglich ist. Die Populationen von Epipactis helleborine im Bereich der Ehrenbürg zeigen sich durchaus einheitlich; lediglich bei der Färbung der Perigonblätter lassen sich die unterschiedlichsten Varianten ausmachen, vom blassen Grün bis hin zum Purpurviolett reicht die Farbskala des Epichils. Als relativ verbreitete Waldart besteht für den Bestand von Epipactis helleborine im Bereich der Ehrenbürg keine Gefährdung. |